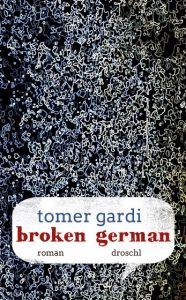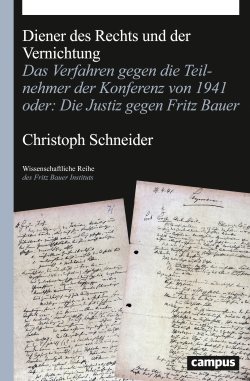 Dies ist die Geschichte eines Versuchs der Strafverfolgung. Strafverfolgung ist im Bereich der nationalsozialistischen Gewaltverbrechen ein bitteres Kapitel, im Feld der Morde an Kranken und Behinderten ein bittereres noch. Der Versuch ist fehlgeschlagen, zudem wäre es fast gelungen, ihn vergessen zu machen.
Dies ist die Geschichte eines Versuchs der Strafverfolgung. Strafverfolgung ist im Bereich der nationalsozialistischen Gewaltverbrechen ein bitteres Kapitel, im Feld der Morde an Kranken und Behinderten ein bittereres noch. Der Versuch ist fehlgeschlagen, zudem wäre es fast gelungen, ihn vergessen zu machen.
Es ist eine kulturwissenschaftlich erprobte Methode, über folgenlose Anstrengungen, über das Nachgeschriebene und Weggedrückte auf den Gegenstand zurückzukommen. Der Gegenstand: Die Spitze der Justiz des Deutschen Reichs trifft sich auf Einladung des Justizministers am 23. April 1941 und lässt sich über den Mord an den Anstaltspatienten informieren – von den Haupttätern.
Dies ist auch eine Fritz Bauer-Geschichte: Er initiierte 1960 ein Verfahren gegen die Teilnehmer der Konferenz von 1941. Zwei Jahre nach seinem Tod wird das Verfahren beendet, zehn Jahre nach seinem Tod scheint es vergessen zu sein.
Was nicht erinnert werden durfte, was nicht gesühnt werden konnte, was nicht geschehen sein sollte – zusammen ergibt es ein eindrucksvolles Bild.
Christoph Schneider ist freier Autor und Kulturwissenschaftler. Er arbeitet zu NS-„Euthanasie“ sowie zur Rezeption der NS-Vernichtungspolitik in Filmen, Nachkriegsprozessen und der Populärkultur.